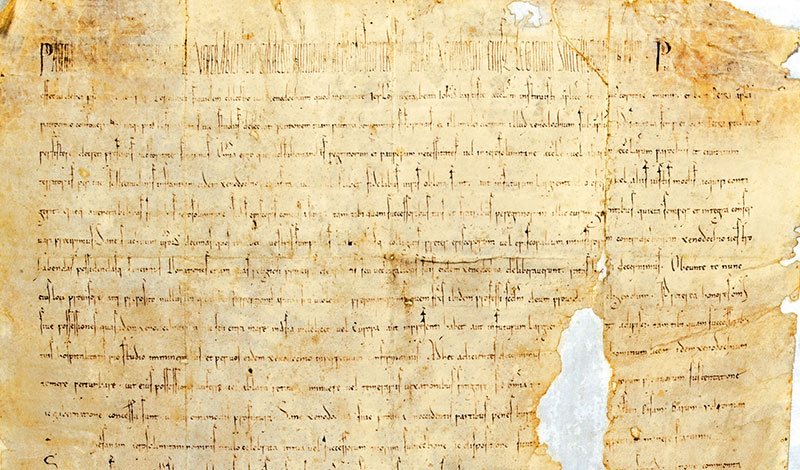Interview mit Dr. Marie Theres Benner, Expertin für Public Health bei Malteser International, zum Thema Ebola
Wir zählen bereits fast 5.000 Tote und die Zahl der Neuinfizierten steigt weiter an: Was macht dieses Virus so besonders tückisch?
Bisher gibt es noch keinen für den breiten Einsatz am Menschen zugelassenen Impfstoff gegen die Viruserkrankung. Nur die Symptome können behandelt werden. Daher hat das Virus inzwischen eine solch epidemische Verbreitung und eine Dynamik erreicht, die sich bis dato niemand vorstellen konnte. Derzeit stirbt durchschnittlich jeder zweite mit Ebola Infizierte an dieser Krankheit. Wenn allerdings die derzeitigen Tests mit Impfpräparaten erfolgreich sind, so könnten laut Weltgesundheitsorganisation erste Chargen Anfang Januar in Westafrika verteilt werden.
Betroffen sind vor allem die westafrikanischen Länder Liberia, Guinea und Sierra Leone. Welche Auswirkungen hat Ebola auf die sozialen Systeme in diesen Ländern?
Ebola hat hier eine Region getroffen, deren Bevölkerung unter großer Armut und den Folgen langer kriegerischer Auseinandersetzungen leidet. Nun brechen in den betroffenen Ländern auch die Wirtschaft und die sozialen Dienstleistungen zusammen: Felder können nicht mehr bestellt werden, weil viele Bauern erkrankt sind; Schulen sind geschlossen, weil die Lehrer nicht mehr unterrichten können; Familienstrukturen brechen auseinander. Die Angst vor dem Virus hat eine große Panik in der Bevölkerung ausgelöst, unzählige Familien sind durch den Tod von Angehörigen und Freunden zutiefst erschüttert. Die Grenzen zu den betroffenen Regionen sind geschlossen, so dass ursprüngliche Markttätigkeiten ausbleiben; die Preise für Nahrungsmittel steigen. UN-Organisationen wie das Welternährungsprogramm warnen davor, dass die Epidemie die Existenz der Menschen in den betroffenen Gebieten langfristig gefährden werde. Das gewaltige Ausmaß dieser Epidemie ist von einzelnen Akteuren nicht mehr zu bewältigen. Darum rufen auch wir dazu auf, alle Expertise und alle verfügbaren Kräfte zu bündeln, um gemeinsam gegen diese Krankheit vorzugehen. Das ist eine große Herausforderung für die internationale Gemeinschaft.
Auch in westlichen Krankenhäusern infizieren sich Pfleger trotz strengster Sicherheitsvorkehrungen. Einfach gefragt: Wie kann das überhaupt passieren?
Das Ebola-Virus wird durch direkten Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten wie Schweiß, Speichel, Stuhl oder Urin übertragen. Schon die kleinste Unachtsamkeit beim Ablegen der Schutzkleidung birgt beispielsweise ein sehr großes Risiko für eine Infektion. Denn die Viren, die sich nach dem Kontakt mit einem Ebola-Patienten auf der Schutzkleidung des Pflegers befinden, können schon durch einen kleinen Riss in der Haut direkt ins Blut oder durch eine unbewusste Berührung von Nase, Augen oder Mund direkt in die Schleimhäute gelangen.
In den betroffenen Regionen in Westafrika arbeitet das Pflegepersonal unter ganz anderen klimatischen Bedingungen und mit einer viel simpleren Ausstattung. Was sind die besonderen Herausforderungen für die Helfer vor Ort? Woran fehlt es am meisten?
Zunächst möchte ich diesen Helfern und Pflegern meine größte Hochachtung aussprechen. Sie arbeiten unter einfachen Bedingungen bei tropischem Klima mit hohen Temperaturen und starker Luftfeuchtigkeit. Es ist kaum möglich, länger als ein bis zwei Stunden in dieser einengenden Schutzkleidung zu bleiben. Hinzu kommt der enorme psychische Druck, dem die Pfleger ausgesetzt sind: die Angst, sich zu infizieren, die Angst, einen Fehler zu machen – zum Beispiel beim Ablegen der Schutzkleidung. Diese Helfer und Pfleger sollten einen „Nobelpreis“ bekommen!
Was wir in diesem Zusammenhang nicht vergessen dürfen, ist die Tatsache, dass das Gesundheitssystem in den betroffenen Ländern grundsätzlich schwach und schlecht ausgestattet ist und es schon in „normalen“ Zeiten kaum so etwas wie eine Basisgesundheitsversorgung gibt. Daher fehlt es auch jetzt vielfach an der notwendigen Schutzkleidung für das Gesundheitspersonal sowie an Trainings für den Umgang mit dieser Krankheit, bei denen die Pfleger beispielsweise auch lernen, die Schutzkleidung richtig an- und abzulegen – was gar nicht so einfach ist.
Die WHO stellt einen Impfstoff frühestens für Januar 2015 in Aussicht. Was ist jetzt eine wirksame Strategie, um die Epidemie einzudämmen?
Wie bei den meisten Infektionskrankheiten sind eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sowie im Fall von Ebola die Isolierung der Patienten die Grundvoraussetzungen, um die Epidemie zu kontrollieren. Zudem müssen natürlich alle Kontaktpersonen von Ebola-Patienten ausfindig gemacht und untersucht werden und – wenn nötig – isoliert werden, um zu verhindern, dass sie weitere Menschen infizieren. Die Strategie der frühzeitigen Diagnose, Behandlung und Isolierung hat sich auch bei früheren Ebola-Epidemien bewährt und führte in Guinea zu einem enormen Rückgang der Todesfälle von 90 auf 40 Prozent.
Welches sind aus Ihrer Sicht die dringlichsten Maßnahmen?
Zunächst müssen ausreichend Schutzkleidung bereitgestellt und die entsprechenden Trainings für das Gesundheitspersonal organisiert werden. Weiterhin muss auch für die notwendige moralische und psychische Unterstützung der Helfer gesorgt werden. Darüber hinaus werden dringend mehr Ebola-Behandlungszentren gebraucht, aber auch genügend Labors und qualifizierte Mitarbeiter für die frühzeitige Diagnose und Behandlung. Hier hoffen wir natürlich auch auf die in Aussicht gestellten Ebola-Schnelltests und positive Testergebnisse bei den Impfpräparaten, die derzeit erprobt werden. Sauberes Trinkwasser und sanitäre Anlagen sowie logistische Unterstützung sind ebenfalls unabdingbar. Natürlich benötigen die betroffenen Länder auch Unterstützung beim Aufbau einer funktionierenden Basisgesundheitsversorgung.
Ebola wirkt sich nicht nur auf das Gesundheitssystem der betroffenen Länder aus, sondern hat auch weitreichende soziale Auswirkungen. Welche flankierenden Maßnahmen sind hier notwendig?
Genau. Die Epidemie hat weitreichende Folgen für die Wirtschaft, Sicherheit und Stabilität der betroffenen Länder. Deswegen muss jetzt aktuell auch die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung sichergestellt werden. Denn trotz Erntezeit konnte vielfach die Ernte nicht mehr eingeholt werden. Und im Hinblick auf die nächste Aussaat von März bis Mai nächsten Jahres muss schon jetzt geprüft werden, welche Hilfe die Bauern brauchen. Mittel- bis langfristig werden hier weitere Nahrungsmittelhilfen notwendig sein.
Das Thema Ebola beherrscht derzeit weltweit die Medien. Seit den Infektionsfällen in Madrid und Dallas scheint der Virus gefühlt „nähergerückt“ und der Respekt vor einer möglichen Ansteckung ist auch hierzulande groß. Warum ist die Spendenbereitschaft dennoch so gering?
Ich vermute, dass es einerseits damit zusammenhängt, dass es derzeit einfach zu viele Krisen gleichzeitig auf der Welt gibt. Andererseits erwarten viele Menschen wohl von den Gesundheitsbehörden in den betroffenen Ländern, dass sie die Epidemie selbst in den Griff bekommen. Doch wir sollten trotz allem realistisch bleiben und keine Panikmache betreiben. Die meisten Ebola-Fälle gibt es in Westafrika – und dort brauchen die Menschen dringend unsere Hilfe!
Was tut Malteser International konkret?
Da Malteser International derzeit noch keine eigenen Strukturen und Mitarbeiter in den betroffen Ländern Westafrikas hat, erfolgt die Hilfe im Rahmen des internationalen Netzwerks des Malteserordens, beispielsweise über die französische Partnerorganisation „Ordre de Malte France“, die schon seit Jahren in Guinea und Liberia tätig ist. Zudem denken die Malteser als Mitglied von „Aktion Deutschland Hilft“ zusammen mit weiteren Mitgliedsorganisationen über eine Ebola-Taskforce und einen gemeinsamen Hilfseinsatz nach. Denn eine Hilfsorganisation alleine kann im Fall der Ebola-Epidemie angesichts der Komplexität der Krise nur wenig ausrichten. Wir als originäre Gesundheitsorganisation könnten uns im Rahmen dieser Taskforce die Einrichtung eines Labors oder die Unterstützung von Ebola-Schnelltests oder Impfkampagnen in einem der betroffenen Länder vorstellen – in Verbindung mit Präventionsmaßnahmen wie Trainings und Schutzkleidung für das lokale Gesundheitspersonal. Doch allein für ein solches Labor benötigen wir rund 400.000 Euro; ein Schutzanzug kostet rund 60 EUR. Für die 24-Stunden-Betreuung eines einzelnen Ebola-Patienten durch eine Krankenschwester oder einen Pfleger werden täglich bis zu 12 Schutzanzüge benötigt.
Vor welchen besonderen Herausforderungen stehen Hilfsorganisationen bei diesem Thema? Und was sind mögliche Lösungen?
Alle Akteure müssen jetzt über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen, ihre Kräfte bündeln und gemeinsam handeln – und zwar jetzt! Die Zeit drängt, denn ohne sofortige umfassende Maßnahmen wird sich die Zahl der Ebola-Fälle von derzeit mehr als 9.000 bis Mitte Januar 2015 auf 550.000 bis 1,4 Millionen erhöhen, so das Zentrum für Infektionskontrolle und Prävention in Atlanta. Dies sollte allen Verantwortlichen Ansporn genug sein, um eine noch größere Katastrophe abzuwenden. Hierfür müssen dringend die notwendigen personellen und finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Allein für ein Ebola-Behandlungszentrum mit 100 Betten werden rund 200 bis 250 Mitarbeiter benötigt. Dies zeigt, wie intensiv und anspruchsvoll die Behandlung von Ebola-Patienten ist.
Wie bereitet Malteser International die eigenen Mitarbeiter vor?
Doch bevor eigene Mitarbeiter entsandt werden, sind umfassende Trainingsmaßnahmen ein wesentliches Element der Einsatzvorbereitung. In anderen afrikanischen Ländern wie beispielsweise in der DR Kongo, wo Malteser International bereits seit vielen Jahren arbeitet und es schon einige Fälle von Ebola gab, haben wir umgehende Schutzmaßnahmen veranlasst und Trainings für unser Personal durchgeführt.
Die Zeit drängt und ich möchte helfen. Was kann jeder einzelne tun, um an der Eindämmung der Epidemie mitzuwirken?
Wir appellieren an die Bevölkerung, an die Unternehmen, die Pfarrgemeinden, die Schulklassen und an jeden einzelnen: Helfen Sie den Menschen in Westafrika mit einer Spende!
Interview: Petra Ipp-Zavazal/Elena Stein, foto: Frank Lütke (Oktober 2014)